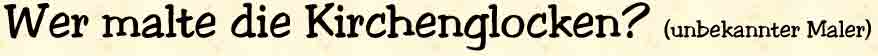 |
||
|
HNA, 15. Januar 2001 |
||
|
"Die Glocken von Christerode" ist der 7itel der Kohlezeichnung,
die jahrelang, als vermeintliche Reproduktion wenig beachtet, im
Dorfgemeinschaftshaus des Neukirchener Stadtteils hing. Die große
Frage: Wer zeichnete die Glocken im Jahre 1939? (Repro: HNAInh)
|
Wer war der Schöpfer? "Die Glocken von Christerode" ist der
Titel einer Kohlezeichnung, die jahrelang im DGH Christerode hing. Vor
Kurzem wurde offenbar, dass es sich um ein Original handelt.
CHRISTERODE Sherlock
Homes lässt grüßen: Den Christeröder Helmut Fälber, eigentlich
Dolmetscher von Beruf, hat der detektivische Ehrgeiz gepackt. Dabei
geht es dem Kunstliebhaber jedoch nicht um Diebstahl oder Schmuggel.
Das Objekt der Begierde ist eine Kohlezeichnung, datiert auf das Jahr
1939 und hing jahrelang an einer Wand im Dorfgemeinschaftshaus
Christerode. Und jahrelang nahm kein Besucher des Hauses großartig
Notiz von der Zeichnung, im Glauben, es handle sich um eine
Reproduktion.
Bis Irene Weißhaar aus Neukirchen, Lektorin bei der
evangelischen Kirche, das Werk Ende vergangenen Jahres genauer unter
die Lupe nahm. Und feststellte: Es ist ein Original. Darauf hin nahm
sich Fälber des "Falles" an. Fälber recherchierte die wechselnden
Besitzverhältnisse der Zeichnung. In vielen Telefongesprächen fand er
heraus, dass sich das Kunstwerk vor vielen Jahrzehnten im Besitz des
Geistlichen Laabs, Dekan im damaligen Kreis Ziegenhain, befand. Laabs,
fand Fälber heraus, war vermutlich der Erstbesitzer.
Seine Witwe, die Klavierunterricht gab, schenkte es Anfang
der 80er-Jahre Regina Heiderich, eine ihrer Schülerinnen. Die wiederum
es 1988 der Gemeinde Christerode schenkte.
|
|
|
Die Zeichnung, hat Fälber überprüft, zeigt eine
originalgetreue Abbildung des Dachstuhls der Kirche Christerode mit seinen
zwei Glocken. Die auf den Glocken eingravierten Daten ‑ die linke wurde
1792 gegossen, die rechte 1627 ‑ sind korrekt. Unleserlich ist leider der
Name des Zeichners, der das Werk signiert hat: Er kann sowohl Hans Lauer,
Bauer oder Sauer geheißen haben. Fälber geht davon aus, dass der Zeichner
eine Beziehung zu Christerode und zum Dekan Laabs gehabt haben muss.
Möglicherweise ist ein junger Referendar der Künstler gewesen. Ein Referendar, der ebenso in Beziehung stand zu den in den 30er-Jahren in Olberode und Oberaula arbeitenden Pfarrern Adam und Schüttrumpf. Von der Knüllgemeinde aus wurde damals Christerode geistlich betreut. (jkö) |
||
